Neues aus der Heide
In den Wintermonaten 2018 / 2019 hat der Naturpark Barnim seiner Schönower Heide eine Verjüngungskur gegönnt. Ziel war es, die Aussaatbedingungen für die charakteristische Besenheide zu verbessern und so die Artenvielfalt in diesem ganz besonderen Lebensraum zu erhalten. Auf dass sich auch weiterhin Glattnatter, Zauneidechse, Ziegenmelker,Wiedehopf und zahlreiche Insekten hier wohlfühlen.
Die Schönower Heide ist kostbar – und darf auch etwas kosten
Flächen wie die Schönower Heide, also trockene, nährstoffarme Offenlandschaften, sind rar geworden in Europa. Dabei dienen sie zahlreichen trockenheits- und wärmeliebenden Arten als Refugium. Um diesen seltenen Lebensraum zu sichern, wurden dem Naturpark Barnim gut 300.000 Euro aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) bewilligt. Mit diesen Geldern konnten großflächige Pflegemaßnahmen beauftragt werden. Zum Schutz der Brutvögel und Reptilien wurden sie in den Wintermonaten durchgeführt.
Schweres Gerät, wo Muffel-, Dam- und Rotwild weiden
Im Bereich des Wildtiergatters trugen so genannte Plagg-und Choppermaschinen ältere Heidepflanzen und die oberste Bodenschicht, den Rohhumus, fachgerecht ab und schufen so wieder gute Aussaatbedingungen für die Keimlinge der Besenheide. Im Anschluss wurde der abgetragene Rohhumus auf umliegende landwirtschaftliche Flächen gefahren und dort zur Humusanreicherung eingebracht. Auf diese Weise profitiert nicht nur die Heide, sondern auch die Landwirtschaft im Naturpark Barnim von den aufwändigen Pflegemaßnahmen.
Der Einsatz der schweren Geräte ergänzt die bisherigen Maßnahmen zur Offenhaltung der Heide: ein gezieltes Abholzen und die Beweidung mit Muffel-, Dam und Rotwild. Es hatte sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Heide allein mit Sägen und hungrigen Weidetieren nicht zu erhalten ist.
Vom militärischen Übungsplatz zum Schutzgebiet
Die Schönower Heide war überhaupt erst durch ihre intensive Nutzung als Truppenübungsplatz entstanden. Jahrelange Panzereinsätze, Bodenverwundungen und wiederholte Flächenbrände schufen diese spezielle Landschaft, die sich nach Beendigung des Militärbetriebs zum kostbaren Lebensraum wandelte. Die charakteristische Besenheide in Verzahnung mit offenen Sandflächen und Sandtrockenrasen prägt ein Biotop, in dem sich immer mehr Arten wohl fühlen. Die Pflege der Heide ist somit automatisch ein Beitrag zur Artenvielfalt.
Beispiel Wiedehopf
Der Wiedehopf braucht offene trockene Landschaften mit einer schütteren Pflanzendecke, um am Boden auf Futtersuche zu gehen. Insekten, Spinnen, Regenwürmer, Schnecken oder auch kleine Eidechsen stehen auf seinem Speiseplan. Er findet sie in der Schönower Heide. Allerdings sind dort geeignete Brutplätze für Höhlenbrüter wie den Wiedehopf Mangelware. Erst seit spezielle Nistkästen aufgehängt wurden, hat sich der Bestand an Brutpaaren erhöht. In anderen Regionen Deutschlands und Europas ist der Wiedehopf-Bestand hingegen stark zurückgegangen.












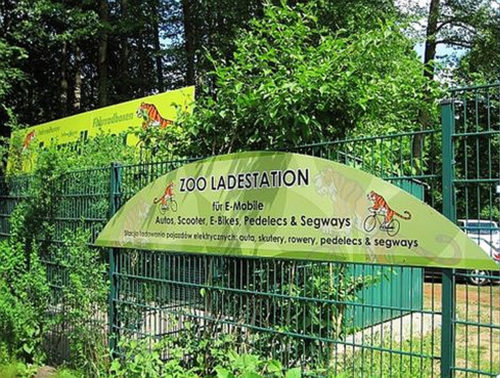

















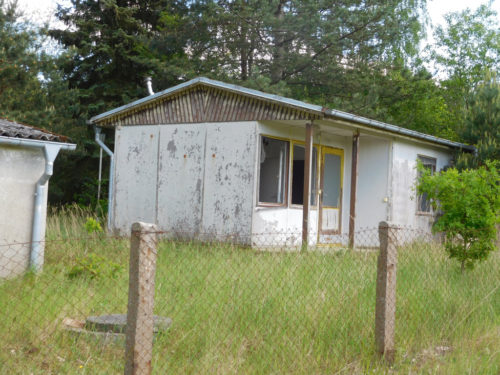
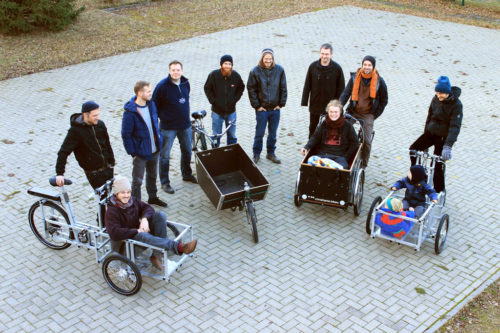









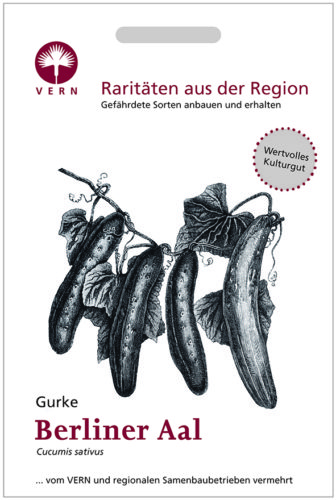
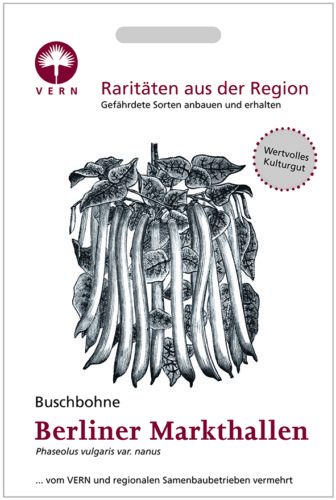





Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.